Kommt ein Gemeindemitarbeiter zum Web-Entwickler und sagt: „Ich brauche eine neue Webseite. Aussehen soll die so wie die von Ihrer Agentur. Mit Bildern, die wackeln, Dingen, die explodieren und Buchstaben, die fliegen.“ Fragt der Web-Entwickler: „Und welche Infos sollen auf die Seite?“ „Weiß ich noch nicht“, sagt der Kunde. „Machen Sie erstmal was Schönes“. Da atmet der Web-Entwickler tief ein und erzählt von dem Gleichnis mit den toten Fischen.
Ein weltweites Netz von Daten zu besitzen, die überall zugänglich sind – das ist die Inspiration für die Entstehung des World Wide Web. Die Idee ist so überwältigend, das man ihre Bedeutung mit der Erfindung des Buchdrucks oder des Fernsehens gleichsetzen kann.
Anders als bei den klassischen Medien ist der Grundgedanke des Webs jedoch, Inhalte von der Präsentationsform zu trennen. Ein Fernseher hat eine feste Auflösung, Bewegt-Bild und Ton transportieren die Botschaft. Webseiten dagegen können je nachdem, von welchem Endgerät aus sie abgerufen werden, verschiedene Formen annehmen. Lediglich die semantische Auszeichnung, also ob es sich etwa um eine Überschrift, Unterüberschrift oder Liste handelt, definiert die Form. Der Browser interpretiert diese Auszeichnungen und entwirft auf ihrer Basis die Präsentation. Mittels Cascading Style Sheets (CSS) kann die Darstellung individuell angepasst werden.
Soweit die Theorie. In der Praxis sind die Inhalte jedoch fest mit der Präsentationsform verankert. Die semantischen Auszeichnungen werden fast ausschließlich zur Darstellung genutzt. Wieso eigentlich? Und inwiefern wird das in Zukunft zum Problem?
Wehret den Anfängen
Das Grundübel liegt in den Anfängen des World Wide Webs. In den 90er Jahren hatten viele Menschen bereits einen Heimcomputer. Den nutzten sie hauptsächlich für Tabellenkalkulation, Dokumente, Präsentationen, Spiele und Desktop-Publishing. Computer, Monitor, Maus und Tastatur waren die einzigen Ein- und Ausgabeformen. Die Präsentationsform war daher für sie optimiert.
Dann war plötzlich jeder online. Man erstellte Webseiten und konsumierte diese hauptsächlich am Heimcomputer. Da man diesen aus der Office-Welt kannte, betrachtete man auch Internetseiten wie Dokumente mit einer festen Breite und Länge. Fälschlicherweise. Denn als Konsequenz passte man die Gestaltung einer Webseite an die Auflösung des Monitors an.
Fischleichen im Content-Meer
Das löste ein Container-Denken aus. Am Anfang stand nicht die Überlegung, welche Inhalte sinnvoll für die Webseite sind, sondern wie man (die noch nicht vorhandenen) Inhalte möglichst ansprechend präsentieren könnte. Dazu definierte man Inhaltscontainer – zum Beispiel Slider, Akkordeons und Karussells. Spätere Inhalte mussten sich den bestehenden Darstellungsformen anpassen. Die Folge: Webseiten mit aufwendig gestalteten Layout-Elementen, in denen bedeutungslose Inhalte herumdümpeln – gleich toten Fischen in einem riesigen Content-Meer.
Die Festlegung auf ein starres Webseiten-Layout ohne Rücksicht auf Inhaltskonzepte wird jedoch spätestens mit der Vielzahl unterschiedlicher Ausgabemedien zum Problem. Denn wir surfen schon längst nicht mehr nur vom heimischen Computer aus im Netz. Neben Smartphones, Tablets und Fernsehern gehen künftig auch Uhren, Brillen, Autos und Kühlschränke online. Jedes dieser Geräte verfügt neben unterschiedlichen Auflösungen auch über unterschiedliche Interaktionsformen – etwa Tastatur, Maus, Touchscreen, Fernbedienung und Sprachsteuerung. Hinzu kommen unzählige Vernetzungen untereinander: Vielleicht navigiert man demnächst im Auto mit einer Sprachsteuerung und benutzt die Smartwatch als Controller für die Ausgabe an einem Monitor in einer Brille. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt.
Back to the roots
Ein einziges Layout für all diese Geräte zu gestalten ist nicht möglich. Stattdessen verlangt die Netz-Vielfalt eine Rückbesinnung auf die Ursprungsidee des Webs: Inhalte überall zugänglich zu machen. Das funktioniert heute mehr als je zuvor nur durch die Trennung von Präsentation und Inhalt. Das Gerät selbst entscheidet über die Darstellungs- und Interaktionsform. Die Semantik beschreibt ausschließlich die Inhalte.
Damit das möglich ist, muss ein Umdenken im Erstellungsprozess von Web-Inhalten in Gang gesetzt werden: Statt der Präsentation rücken die Inhalte an erste Stelle. Erst wenn sie definiert sind, kann die passende Präsentationsform gewählt werden. Man spricht hier vom Content-First-Prinzip.
Intelligent vernetzen
Ein Bonus dieser strukturierenden Herangehensweise: Sie birgt die Chance, neue Ideen für die Präsentation zu entwickeln. Jedes Inhaltselement besitzt beispielsweise eine Reihe von Informationen. So bestehen die Inhalte „Nachrichten“, „Events“ oder „Unternehmensinformationen“ unter anderem aus den Informationen „Nachrichtentitel“, „Ort“ und „Datum“. Diese Elemente können in Relation zueinander stehen. Sowohl eine Nachricht als auch ein Event können eine Ortsangabe haben. Ein Ort ist wiederum über eine Adresse inklusive Geo-Koordinaten definiert. Die Adress-Informationen sind semantisch so ausgezeichnet, dass die unterschiedlichen Browser die Inhalte verstehen. Der Browser im Auto hat eventuell keine große Bildschirmausgabe, besitzt jedoch eine Sprachausgabe. Die Orts-Informationen werden durch die Semantik erkannt und an das Navigationsgerät weitergegeben, die Nachrichten wiederum laut vorgelesen. Auf dem Desktop-Browser wird der Ort dagegen auf einer Karte dargestellt.
„Schade“, sagt der Gemeindemitarbeiter und macht ein enttäuschtes Gesicht. „Also keine fliegenden Buchstaben?“ „Schauen wir mal“, sagt der Web-Entwickler. „Auf jeden Fall keine toten Fische.“
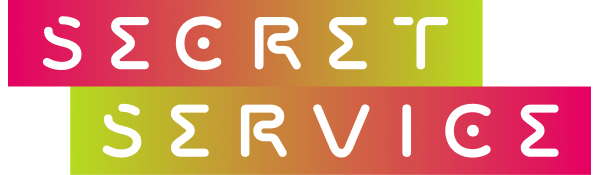
Heiß auf Insider-Infos?
Immer up to date: Unser Newsletter versorgt dich einmal monatlich mit brandneuen Trends und Innovationen aus der Kommunikationswelt.


